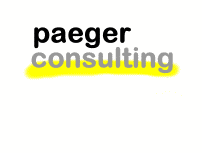|
Ökologie gut, Nachhaltigkeit schwach
Der Pflanzenökologe Hansjörg Küster buchstabiere Nachhaltigkeit neu – dies versprach eine Rezension in der ZEIT (Literaturbeilage zu Nr. 42/2005) von diesem Buch und bewertete es als „außerordentlich wichtig“. Selber Biologe und meine berufliche Tätigkeit als Beitrag zur Nachhaltigkeit verstehend, musste ich das Buch daher natürlich sofort lesen – und habe mich über manches kräftig geärgert.
Aber vorweg: Hauptthema des Buches ist Ökologie und die Betrachtung der menschlichen Geschichte aus ökologischer Sicht. Dieser große Teil ist interessant: Kurz gefasst stellt Küster die Wissenschaft Ökologie dar – und auch einige Tatsachen, die in der Öffentlichkeit kaum bewusst sind: Etwa, dass die Entstehung des Lebens die Erde veränderte und immer noch verändert, die Lebewesen selber also ihren Standort verändern. So ist der Sauerstoff in der Luft ein „Abfallprodukt“ des Lebens. Küster erklärt Nahrungsketten, die Gründe für Häufigkeitsschwankungen bei Organismen, Populationswachstum – und das Ende des Wachstums, wenn die Ressourcen knapp werden. Hierdurch entsteht Stress, der entweder zu Schädigungen der Organismen oder zu Anpassungen führen kann. Anpassungen werden der natürlichen Selektion ausgesetzt: So steuern ökologische Bedingungen auch die Evolution. Und weil sich Standortbedingungen und Organismen ständig ändern, gibt es kein „biologischesGleichgewicht“: Natur ist dynamisch.
Und genau hiergegen lehnt sich der Mensch auf: Die Geschichte des Menschen ist die Geschichte des Versuchs, stabile Lebensverhältnisse zu erreichen. Der Ackerbau und die Viehhaltung veränderten Natur nach menschlichen Interessen, der Handel und die aus ihm folgenden staatlichen Strukturen dienen dazu, die Lebensverhältnisse weiter zu stabilisieren. Mit der Entstehung des Bergbaus kommt es dann zu weiträumigen Waldvernichtung – und als Gegenreaktion zur Entwicklung des Prinzips der Nachhaltigkeit. Dieses kann sich aber im Waldbau erst durchsetzen, nachdem der Brennstoff Kohle die Nachfrage nach Brennholz senkt: Nachhaltige Forstwirtschaft wird jetzt möglich – die Energieversorgung wird mit der Nutzung fossiler Brennstoffe allerdings weniger nachhaltig. Mit der Industrialisierung kommen dann (bescheidener) Wohlstand und Bildung aufs Land; das Land wird zum Gegenbild der Städte, die Landschaft aus dieser Zeit wurde zur Referenz für den Naturschutz: In Wirklichkeit schützt dieser keine Natur, sondern alte Kulturlandschaften, sollte also besser Landschaftsschutz heißen.
Soweit der interessante, lesenswerte Teil des Buches. Die mit der Industrialisierung einhergehenden neuen Umweltprobleme werden dann kaum besprochen, sondern das Potenzial der Industrie für technische Lösungen betont; hier fehlen wichtige Aspekte (wer sich für diese interessiert, dem sei John R. McNeill: Blue Planet, Campus-Verlag 2003, empfohlen).
Aber geärgert habe ich mich nicht hierüber, sondern über eine durchgehende Marotte: Küster scheint es zu stören, dass die Wissenschaft Ökologie und die Ökologiebewegung beide das Wort „Ökologie“ benutzen, wo es doch der Wissenschaft um Beschreibung, der Bewegung aber um „ökologische Utopien“ geht – und für die ist laut Küster in der modernen Welt kein Platz. Um dann argumentiert er auch schon einmal wissenschaftlich zweifelhaft (Seite 63 unter Verweis auf neu entstehende Arten: „Daher kann prinzipiell niemals mit Sicherheit angegeben werden, … ob es zu einem Artenschwund kommt.“ – als ob es irgendeinen Hinweis gäbe, dass das gegenwärtige, vom Menschen verursachte Artensterben von zur gleichen Zeit neu gebildeten Arten kompensiert würde); dann werden die politischen Einschätzungen fragwürdig: Die Ökologiebewegung sei politisch „betont antiliberal und sozialistisch“, das Kyoto-Abkommen mit Vorgaben zur Emissionsreduzierung sei planwirtschaftlich und daher kontraproduktiv (zwangswirtschaftliche Bedingungen hätten schließlich die Umgebung von Tschernobyl verstrahlt) …
Das Kuriose ist: Diese Aussagen scheinen nicht inhaltlich begründet, denn oft teilt Küster in Sachfragen die Positionen dieser Bewegung. Auch beim Artensterben übrigens: „Die Befürchtung ist berechtigt, dass viele Arten noch gar nicht entdeckt sind, während ihr Lebensraum bereits durch Abholzen vernichtet wird. Wenn uns die Erhaltung von Arten wichtig ist, müssen wir uns ganz besonders für die Bewahrung tropischer Ökosysteme einsetzen“ (Seite 130).
Und enttäuschend ist auch die Behandlung der Nachhaltigkeit: Im ersten Kapitel betont Küster noch, dass sich die Basis der ökologischen Forschung und das Ziel der Nachhaltigkeit in einer neuen Weise durchdringen müssen, davon hänge unsere Zukunft entscheidend ab. Dieser Teil des Buches ist dann aber schwach: Konkrete Vorschläge umfassen zwei allgemein gehaltene Seiten („Man sollte überhaupt auf die Transportwege achten.“); und darüber hinaus ist Küster vor allem wichtig, dass wir im Zukunft auf „zwangswirtschaftliche Maßnahmen“ – wir erinnern uns: solche wie das Kyoto-Protokoll! – verzichten: Freiwilligkeit, Bildung und Forschung seinen die Grundlage für Nachhaltigkeit. Es ist sicher nicht falsch, eine bessere Naturerziehung zu fordern: Aber dass wir alleine damit die Nachhaltigkeit erreichen, scheint doch fraglich.
Zusammengefasst: Eine allgemeinverständliche Einführung in die Wissenschaft Ökologie und ein Überblick über die ökologische Einordnung der menschlichen Geschichte ist das Buch; Nachhaltigkeit neu buchstabiert hat es nicht.
© Jürgen Paeger 2005
|